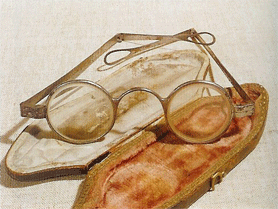
Below you will find actual projects and expositions – generally not published yet – dealing with Johann Gottfried Herder. If you have any queries or suggestions, please contact the authors directly; if you want to get affiliated to this projectlist, please send a short synopsis to webmaster@johann-gottfried-herder.net.
J. G. Herders frühe Predigten. Königsberg und Riga (1762-1769) Editionsvorhaben der Johann Gottfried Herder-Forschungsstelle am Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien der Universität Erfurt
Das Predigtamt bildet eine der stärksten Konstanten in Herders Schaffen. Es strukturiert seine Biographie, indem die öffentliche Kanzelrede an allen Lebensstationen zu seinen zentralen Aufgaben als Pfarrer und geistlicher Lehrer zählte. Zugleich und paradoxerweise ist die Predigt diejenige Textgattung in Herders Werk, die – gemessen an der Fülle des Materials – am wenigsten bekannt ist. Lediglich etwa ein Drittel von Herders ausgearbeiteten Predigten sind bis heute überhaupt ediert. An dieser Stelle setzt das von der Staatsministerin für Kultur und Medien und der Fritz Thyssen Stiftung gemeinschaftlich finanzierte Projekt an. Zum ersten Mal sollen Herders Predigten gesamthaft nach heutigen philologischen Standards aus den Handschriften ediert werden. Gegenstand des Vorhabens ist hierbei zunächst Herders frühes Predigtschaffen in den Jahren von 1762-1769. Damit ist im Wesentlichen der Zeitabschnitt abgedeckt, den Herder in verschiedenen geistlichen Funktionen in Riga zubrachte. Aus diesen Jahren sind ca. 70 ausformulierte Manuskripte erhalten, die jeweils eine Redezeit von etwa einer Stunde füllten. Neben der editorischen Darbietung des Materials soll eine Einführung erarbeitet werden, die Hilfestellungen zur Einordnung und Auswertung von Herders Predigtschaffen gibt. Leitung:
Michael Popejoy (Purdue University) Kant’s Critique of Rational Theology, the Pantheism Controversy & Herder’s Contribution In chapter 2 I focus on Herder’s Gott: Einige Gespräche as what I take to be perhaps the most important direct philosophical outcome of the Pantheismusstreit in late eighteenth century Germany. This work, as is well known, is situated within an intellectual period in Germany during which many took Spinoza’s philosophy, and pantheism more generally, to be synonymous with atheism. However, there is another strand of thought during this period, of which I take Herder to be a primary spokesperson, for whom this identification of Spinozism with atheism is not only misguided, but also ignores a live option in philosophy and religiosity more generally that is an alternative to traditional theism. In Herder’s Gespräche, Theophron says, „Wie sind [Atheismus und Pantheismus] in Einem und demselben System möglich? Der Pantheist hat doch immer einen Gott“( FHA 4, 686). Herder’s pantheistic picture in the Gespräche plays a large role in kicking off a deep engagement with Spinoza and pantheism in the coming decades of German philosophy. In the context of my larger project, I argue that the religious landscape in Herder’s Germany mirrors contemporary discussions in philosophy of religion between atheists and traditional theists, and that Herder can make a contribution to a contemporary pantheistic approach that shoots this long-standing gap, as Herder himself did in his historical context.
Tina Bellmann Herders theologische Anthropologie. Ein Vergleich zwischen Herders Sprachursprungsschrift und seiner Auslegung von Gen 1–3 (Diplomarbeit) Vor dem Hintergrund der zivilisatorischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts sucht die Arbeit nach einem in der Postmoderne tragenden Menschenbild. Sie findet dieses beim jungen Herder, der sowohl das Paradox in der Natur des Menschen als auch den Gedanken der Achtung der Würde des Anderen in seiner unergründlichen Individualität formuliert. Die Aktualität der Gedanken Herders zeigt sich zudem in der rahmenden Fragestellung nach der Herder-Renaissance in der neueren Theologiegeschichte bei Wolfhart Pannenberg und der Legitimität seiner Inanspruchnahme Herders für das Konzept einer „werdenden Gottebenbildlichkeit“. Anhand des Vergleiches der Sprachursprungsschrift (1772) und des Manuskriptes „Über die ersten Urkunden des Menschlichen Geschlechts“ (1769), die je für den philosophischen und theologischen Zugang Herders stehen, werden die thematischen Kongruenzen in den Ergebnissen bezüglich des Menschenbildes aufgezeigt. Die auf dem empirischen Tier-Mensch-Vergleich ruhenden Aussagen der Sprachursprungsschrift (biologische Mängelwesenthese, die Würdigung der Ganzheit der menschlichen Natur, die freiheitliche Auszeichnung und die ihr zugehörige Gefahr des Scheiterns, die Einheit der Vernunft mit den aisthetischen Vermögen des Menschen und die daraus folgende Sprachgenese, deren Individualität und Sozialität) finden ihr Pendant in Herders Genesisauslegung. Hier dient seine poetische Hermeneutik als Schlüssel, um die biblischen Symbole in ihrer Aktualität zugänglich zu machen. Die herausgehobene Stellung des Menschen im Schöpfungsbericht wird mit der Gottebenbildlichkeit und Tierbenennung bezeichnet. Die Auslegung von Gen 3 schildert den Gehalt dieser Urkunde als den Anfang der menschlichen Mühsal, die eine symbolhafte Fassung der Mängelwesenthese ist. Herder gelingt es somit, das Widersprüchliche in der menschlichen Natur zusammenzudenken: biologischer Mangel und Besonnenheit hier, Gottebenbildlichkeit und Mühsal dort. Trotz der Fehlbarkeit des Menschen betont Herder stets den Aspekt der unverlierbaren Menschenwürde und bleibt damit anschlussfähig für die Gegenwart. Für ihre Diplomarbeit an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.erhielt Tina Bellmann den Herder-Förderpreis für Studierende "Glaube und Erfahrung. Christlicher Glaube ist erfahrbar". Der Preis wurde am 30.8. 2013 bei einem Empfang von Kirche und Diakonie anlässlich des Geburtstages Johann Gottfried Herders in der Weimarer Herderkirche verliehen. Der Herder-Förderpreis wurde vom Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Weimar, dem Sophien- und Hufelandklinikum Weimar und der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein im Gedenken an Herder ausgelobt. Die Laudatio hielt PD Dr. Klaus Scholtissek, Geschäftsführer der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH und Privatdozent an der Theologischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena. "Frau Bellmann erschließt in vorbildlicher Weise das Menschenbild Herders als zentrale Achse seines Werkes. Herders Betonung der Geschöpflichkeit und der Schöpferkraft jedes Menschen ist gerade im 21. Jahrhundert zeitgemäß und auf der Höhe der anthropologischen Selbstvergewisserung”, so der Laudator. (Quelle: www. kirchenkreis-weimar.de/kirchenkreis/aktuelles/20175.html © Karin Marschall)
Dissertations:
Tanvi Solanki tsolanki@princeton.edu "Style and Physiology: Training a New Reading Advisors: Abstract: This dissertation project begins by contending that J.G. Herder’s concern with the speed and components of oral transmission– of tones and accents – in his concept of poetry and translation (for example the 1773 “Auszug aus einem Briefwechsel über Ossian”) and in his imagined, projected media history of Greek versus German cultural techniques (in early texts such as Fragmente über die neuere deutsche Literatur, Abhandlung über die Ode, Kritische Wälder, Der Redner Gottes to the later Briefe zur Beförderung der Humanität and “Homer und Ossian”) is not a desire of a return to a “primordial orality” or the “mother’s mouth.” It is, in other words, not merely a fantasy to be entirely rid of techniques of erudition, despite his rhetoric of vitality and a proto-Romantic “reverie of the origin.” It is, rather, a project of regulating, of modulating the temporality of aesthetic processes (which are, for Herder, physiological) in the particular medial conditions both of the expanding, diversifying print market and of the contemporary culture of erudition. Throughout his oeuvre, from the personal reflections and drafts of future projects, in his Journal meiner Reise in 1769 to his early reviews in the Enlightenment bookseller/distributor Friedrich Nicolai’s Allgemeine Deutsche Bibliothek and in his later pedagogical and theological writings, Herder critiques the culture and reading practices of Gelehrsamkeit while simultaneously being embedded in it. He uses declamations and the aural as a corrective or regulatory measure for the then cultural crisis brought on by print culture as well as the fast-fading culture of learnedness. Though he is not directly calling for declamations or an overall shift back to the oral tradition, his pedagogical impetus to train the “German ear” to perceive the rhythm of the hexameter is an attempt to regulate this medial situation of the ‘simultaneous flood of books.’ The project begins by tracing Herder’s attempt to cultivate a medium to transmit to a new reading public, focusing on how units like meter are means of transport of particular affects for pedagogical purposes. The readings of Herder’s pedagogy, sermons, texts on language, aesthetics and literary criticism in this chapter will be informed by Gottsched, Baumgarten, and Klopstock’s earlier texts on techniques of oration, aesthetic training and prosody. The second chapter of the dissertation will focus on the ‘Seelenärzte’ and medical doctors circulating in Halle (Bolten), Berlin (Karl Philipp Moritz), Zürich (Samuel Tissot), Hannover (Georg Ballhorn and Zimmermann) concerned with diagnosing ‘sicknesses of the soul’, supposedly a result of ‘pathological’ silent reading techniques. Here too, the reader/listener is set up as a biological/physiological entity. Different verse forms (for Bolten the anacreontic ode for e.g.) and their performance have a physiological-anthropological grounding and serve as techniques of regulating the health of the new reading subject, endangered by various ‘reading pathologies’, most famously Lesesucht. I plan to follow through Herder’s project of determining poetic verse, whose speed of transmission bears a regulative function, to the seemingly unregulated, jarring prose of Jean Paul Friedrich Richter, who writes in the midst of wide-spread pedagogical reforms from the 1780s-1830s. Having imbibed the discourse of the learned at a startlingly fast pace and with great breadth, feeds it back to the book market with texts labeled “grotesque,” themselves critiquing various erudite figures while at the same time replicating and functioning according to their discourse. The prose functions as unhinging the new reading subject while itself being a result of the training described above. Finally, the dissertation hopes to close with the work of Wilhelm von Humboldt on the historical development of particular forms of language and its vocal articulation (particularly the 1836 “Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues”) as a continuation and consequence of Herder’s project to train a new reading subject.
Kaspar Renner kaspar.renner@german.hu-berlin.de Titel: „Vitae, non scholae discendum“. Bildungsgeschichtliche Perspektiven auf das Werk Johann Gottfried Herders. 1744 bis 1803. Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für deutsche Literatur, Lehrstuhl von Prof. Dr. Joseph Vogl Abstract: In dieser Doktorarbeit wird das Werk Herders aus bildungsgeschichtlicher Perspektive neu gedeutet. Es soll das Gesamtwerk in den Blick genom-men werden, mit einem Schwerpunkt auf dem Frühwerk. Dabei wird eine Doppelbewegung rekonstruiert: Zum einen sind Bildungsinstitutionen die Voraussetzung für Herders Reden und Schreiben. So sind seine erst in jüngerer Zeit stärker berücksichtigten Schulreden, zum Beispiel „Über den Fleiß in mehreren gelehrten Sprachen“ aus dem Jahr 1764, unmittel-bar an eine lokale Schulöffentlichkeit gerichtet. Zum anderen profiliert sich Herders Schreiben gerade in einer dezidierten Abwendung von den Bildungsinstitutionen, in die er hineingewachsen ist. So entwirft sich Herder im „Journal meiner Reise im Jahr 1769“ als freier Schriftsteller, der nicht an seine Tätigkeit als Angehöriger des gelehrten Standes – das heißt als theologisch ausgebildeter Lehrer und Prediger – gebunden ist. In Herders eigener Bildungsgeschichte spiegelt sich somit eine Entwick-lung, die als charakteristisch für das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts gelten kann. Neben der Schul- und Universitätsöffentlichkeit, an die sich gelehrte Autoren richten, entwickelt sich eine neue Form der literarisch gebildeten Öffentlichkeit, an die sich Herder in seinen literaturkritischen Schriften wie den „Fragmenten“ wendet. Die Entwicklung von Herders Autor- und Werkkonzept kann also nur angemessen verstanden werden, wenn die gleichzeitige Transformation des Bildungswesens – Schule, Hochschule, Gemeinde – sowie der damit verbundenen Öffentlichkeiten in den Blick genommen wird. Entsprechend wurde Herders Werk in der Forschung, insbesondere in Gunter E. Grimms „Letternkultur“, bereits als Übergangsphänomen zwischen einer alten Kultur der Gelehrsamkeit und neuen Formen von Bildungsgeselligkeit beschrieben. Dieser Befund ist für die unterschiedlichen Werkphasen, insbesondere mit Blick auf das vieldiskutierte Verhältnis von Herders Früh- und Spät-werk, jedoch genauer zu differenzieren. Um dies zu leisten, verfährt die Arbeit werkbiographisch, das heißt, sie rekonstruiert Herders Leben und gleichzeitiges Schreiben als Bildungsgeschichte, die einerseits zeitlich strukturiert ist (familiäre Sozialisation, Übergang von der Schule zur Hochschule, eigene Amtstätigkeit), andererseits an bestimmte Institutio-nen und damit verbundene räumliche Kontexte gebunden ist (Mohrunger Lateinschule, Königsberger Universität, Bückeburger Hofkirche). Da Herders Schreibweise an seine jeweilige Lebenslage gebunden ist, erscheint eine bildungsgeschichtlich informierte Biographie als ange-messene Gattung, um sein Werk zu rekonstruieren. Das gilt umso mehr, als sich gerade zu Herders Zeit das Modell einer Biographie durchzu-setzen beginnt, die den Lebenslauf als (geglückte oder missglückte) Bildungsgeschichte erzählt. Die Quellenlage für das beabsichtigte Projekt ist überaus günstig. So kann nicht nur auf Herders gedrucktes Werk, sondern auch auf seine handschriftlichen Entwürfe zurückgegangen werden, die seine Einbin-dung in verschiedene Bildungsinstitutionen („Braunes Buch“), sowie die daraus erwachsende oder damit konkurrierende schriftstellerische Produktion („Silbernes Buch“) dokumentieren. Gleichzeitig wird der seit 2012 vollständig kommentierte Briefwechsel herangezogen, um zu rekonstruieren, wie Herder sein Bildungsprojekt im privaten Bereich fortsetzt, etwa in der Lektüreerziehung Caroline Flachslands. Aus diesem Geflecht von Zeugnissen soll Herders Lebens-, Bildungs- und Schreibgeschichte rekonstruiert und damit ein Beitrag sowohl zur historischen Bildungsforschung des 18. Jahrhunderts, als auch zur Herder-Philologie geleistet werden.
Tobias Heinrich tobias.heinrich@gtb.lbg.ac.at Titel: „Dies, glaube ich, ist das einzige Mittel, dem Tode zu trotzen“: Herders Biographik Universität Wien, Institut für Germanistik. Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Franz M. Eybl Abstract: Die Dissertation wird sich mit der Funktion biographischen Schreibens im Werk Johann Gottfried Herders befassen. Die Auseinandersetzung wird von folgenden grundlegenden Fragestellungen geleitet: 1 Inwiefern reflektieren Herders theoretische Überlegungen zur Biographie, als auch die von ihm verfassten biographischen Texte, das Problem der Darstellbarkeit eines Lebenszusammenhangs im (narrativen) Text? 2 Herders Bedeutung für eine Neubestimmung von Funktion und Rolle des Autors in der Ästhetik der Spätaufklärung ist unbestritten. In seinen biographischen Texten nutzt Herder den Begriff der Autorschaft, um Zusammenhänge in den Werken eines Schriftstellers zu stiften. Die Texte eines Autors sollen transparent werden in Hinblick auf den ‚schöpferischen Geist’, der ihnen zugrunde liegt. Welche Konzepte von Autor, Leben und Werk stehen hinter diesem Verfahren und wie wird ‚Autorschaft’ von Herder im Rahmen biographischer Texte inszeniert? 3 In den biographischen Texte Herders finden sich Gattungsmerkmale unterschiedlichster Herkunft (aus religiösen und wissenschaftlichen Diskursen, narrativen Texten und Gebrauchsliteratur). Welche Implikationen ergeben sich daraus für die Textsorte Biographie? Die Dissertation soll damit am Beispiel der biographischen Texte einen Beitrag zur Debatte um Herders hybride Gattungskonzepte leisten. Andererseits möchte ich exemplarisch zeigen, in welcher Form Umbrüche in der Ordnung des Wissens (in Bereich der Anthropologie, der Literatur, etc.) im 18. Jahrhundert zu einem Paradigmenwechsel für biographisches Schreiben geführt haben, dessen Auswirkungen auch noch für die gegenwärtige Debatte um die Darstellbarkeit von Leben im Text (‚life writing’) bestimmend sind.
Habilitations:
Rainer Wisbert rainer.wisbert@johann-gottfried-herder.net Titel: „Herders Theorie der Schule. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Neuhumanismus“ Philosophische Fakultät der Universität zu Köln Betreuer: Prof. Dr. Menze und Prof. Dr. Irmscher. Abstract: Herder`s neohumanistic theory of teaching and learning is founded in hisphilosophy of education and his philosophy of history. It is narrowly relatedto the ideal of Bildung and the self-determination of subjects in the traditionof European Enlightenment. To deal with Herder sheds new light on therelationship between the neohumanistic theories of education and the modernworld.
Martin Momekam-Tassie, Universität Douala, Senegal martin.momekam@johann-gottfried-herder.net Titel: "Herders kulturpolitisches Denken" Abstract: Cultural diversity rather to be a subject for exclusion and discrimination should nowadays give more opportunities for exchange and communication between groups or peoples. By writing the history of mankind herder extended this idea in universal context, and although this Thought has been today subject for discussion and different views, it but offers some aspects, which entirely need some examination. And how cultural Thought can go beyond nationalism is one of the main aspects under many others to interesse us.
|
| English | German |